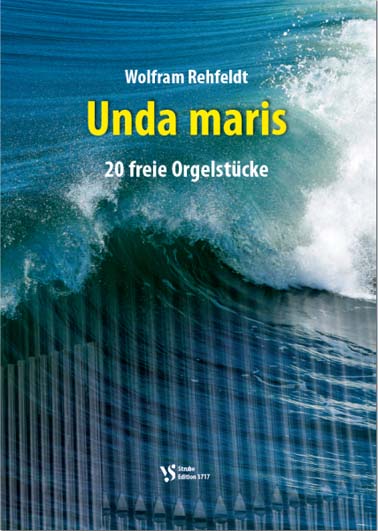Wolfram Rehfeldt
Unda maris
20 freie Orgelstücke
In meiner Heimatgemeinde steht das Taufbecken im hinteren Teil der Kirche. In der Gründungszeit der Kirche war es üblich, dass Ungetaufte die Kirche nur durch den Eingang am Turm betreten durften und vor dem Eintritt in das Gotteshaus getauft werden mussten. Diese bauliche Situation hat man bis zum heutigen Tag erhalten. Dadurch muss der Pfarrer bei Bedarf durch das ganze Kirchenschiff vom Altar zum Taufstein gehen, nach der Taufe zur Segnung am Altar mit der Taufgemeinde denselben Weg zurück.
Das könnte die Stunde der Kirchenmusik sein. „Dudel, bis wir vorn am Altar sind“, sagte mein Pfarrer damals immer. Diese Wanderzeit im Gottesdienst war je nach Größe und körperlicher Fitness der Taufgemeinde sehr unterschiedlich – da war ein Bachscher Orgelbüchlein-Choral möglicherweise zu lang, eine einzelne Choralstrophe zu kurz.
Hier hätte man die vorliegende Sammlung von Wolfram Rehfeldt gut gebrauchen können. Der Charakter der zwanzig Orgelstücke ist „vorwiegend relativ ruhig angelegt“, so der Komponist, „entsprechend dem Hefttitel ‚Unda maris‘“. Hier mag die ruhig auflaufende Meereswelle ebenso Pate gestanden haben wie das Orgelregister mit seinem leicht schwebenden, fast ätherischen Klang. Registrierungsangaben macht Rehfeldt nicht, „da die Orgeln grundsätzlich sehr unterschiedlich sind“. Gut die Hälfte der kleinen „Meditationen“ haben eine sehr gesangliche Solostimme, die aber im Notfall auch auf nur einem Manual dargestellt werden kann.
Die „fehlenden“ Registrierungen sind bei Rehfeldt auch Programm. Er will die Spieler seiner Stücke dazu anregen, mit dem Notenmaterial zu spielen. Es kommt immer darauf an, „an welcher Stelle ein Stück untergebracht werden soll oder welches die Nachbarstücke sind. Es kann ja durchaus reizvoll sein, ganz gegensätzliche Klangfarben auszuprobieren, und so empfehle ich, die eigene Fantasie walten zu lassen.“
Der besondere Clou dieser kleinen Stücke aber ist die „häufig modulare Schreibweise“. Durch sie erhält man Stücke von quasi flexibler Länge. Da gibt es Stellen, an denen man problemlos springen, oder Module, die man wiederholen kann. Beides ist nichts genuin Neues – dennoch kann man durch die bewusst einkomponierten Weichen hier schnell reagieren und die Dauer des jeweiligen Stücks nachregulieren, verkürzen bzw. verlängern. Aber Achtung: Die einzelnen Module sind nicht besonders gekennzeichnet! Sich beim Üben einen Überblick über die Struktur der Stücke zu machen, kann deshalb von Vorteil sein, denn nicht nach jeder vier- oder achttaktigen Phrase ist auch automatisch ein Modul zu Ende!
Rehfeldts Orgelstücke kann man auch als Probestücke dafür sehen, um sich selbst in der Kunst der Improvisation zu üben: einfache Spielfiguren, ostinatohafte Figuren, Septakkorde in allen Umkehrungen – dies alles darf man hier lernen und üben. Vielleicht schleicht sich dann zwischen den Rehfeldtschen Modulen auch einmal ein eigenes improvisiertes Modul des Organisten mit ein. Dazu könnte dieser Band – neben seiner ohnehin hohen Praktikabilität für nebenamtliche Organisten – gut einladen!
Ralf-Thomas Lindner