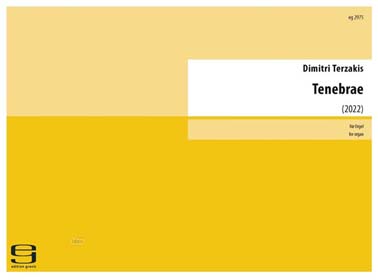Dimitri Terzakis
Tenebrae (2022) für Orgel
Sein musikalisch prägendes Schlüsselerlebnis hatte der 1938 in Athen geborene Dimitri Terzakis auf dem heiligen Berg Athos. „Dort wurde ihm bewusst, dass sich gute Musik mit sehr einfachen Mitteln komponieren lässt.“ Tenebrae (2022) ist Terzakis’ drittes Orgelwerk. Im gesamten Stück ist jeder Hand und dem Pedal, bis auf wenige Ausnahmen mit Zweiklängen wie etwa parallelen Quinten, nur jeweils eine Stimme zugeordnet. Die Komposition ist in viele unterschiedliche Abschnitte unterteilt, für die Terzakis die Metronomzahlen angibt. Der Komponist verzichtet auf Registrieranweisungen, dafür ist die Dynamik genau festgelegt. Nach einer sehr schnellen ff-Skala über drei Oktaven und einem kurzen Schmerzensmotiv folgt ein melodisch ruhiger Abschnitt, der unmittelbar in einen etwas bewegteren, metrisch ungebundenen übergeht. Die melodischen Linien zeichnen sich oftmals durch Tonwiederholungen und kleine Intervallfortschreitungen sowie synkopierte Überbindungen aus.
Aufgrund der Gleichzeitigkeit unabhängiger melodischer Ereignisse in verschiedenen Stimmen richtet sich das Werk vor allem an rhythmisch versierte Spieler. Die Taktarten wechseln häufig. Im Takt 64 kombiniert der griechische Komponist in der rechten Hand schnelle Halbtonwechselnoten und Tonrepetitionen mit Achtelzweierbindungen und kurzen Einwürfen im Pedal. Eine mit „hektisch“ überschriebene Episode erhöht die musikalische Spannung aufgrund von unregelmäßigen kurzatmigen Gesten, die zudem im Fortissimo gespielt werden. Die darauffolgende schnelle Sechzehntelsextolenskala, als Pedalsolo, stellt den Übergang zu Manualsechzehnteln her, die „schnell“ und „nicht zusammen“ zu spielen sind. Sie werden von Pedalliegetönen unterstrichen.
In den Takten 109, 110 und 111 erscheint in der rechten Hand eine f-Phrase, die den Ton cis4 beinhaltet und aufgrund der insgesamt hohen Lage auf kaum einer Orgel gespielt werden kann. An Orgeln mit einem großen Fundus an 4’-Registern lässt sich diese jedoch durch Oktavierung originalgetreu darstellen. Gegen Ende der Komposition, ab Takt 171, beruhigt sich der Grundduktus. Über Quinten in der linken Hand erhebt sich eine ruhige Melodie, flankiert von kurzen Pedalwechselnoten. Ein kurzes Pedalsolo wird nach und nach crescendiert und von einer in allen Stimmen gespielten sechstaktigen Unisonopassage abgelöst. Eine über drei Oktaven gehende senza misura-Skala leitet in die letzten vier Takte über, die im Zweivierteltakt geschrieben sind. Zwei Unisono-Achtelton-Wiederholungen in allen Stimmen bilden den Abschluss.
Die Ausgabe in Ringbindung zeichnet sich durch gute Lesbarkeit aus. Ein kurzes Vorwort, in dem etwa auf den Bezug zum Titel Tenebrae eingegangen wird, wäre angebracht gewesen. Wer sein Konzertprogramm mit einem ungewöhnlichen Orgelstück verfeinern möchte, liegt mit Tenebrae genau richtig.
Jürgen Geiger