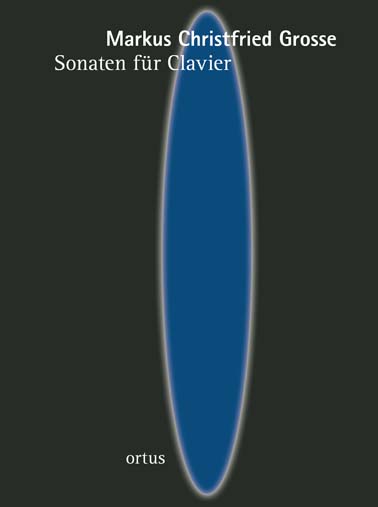Markus Christfried Grosse
Sonaten für Clavier
hg. von Martin Böcker
Wie von ortus gewohnt handelt es sich um eine vorbildliche Ausgabe des Verlages. Ekkehard Krüger verfasste ein Vorwort von fünfeinhalb Seiten, die alles Erreichbare um den kaum be- und geachteten Komponisten, den Organisten und Musiklehrer Markus Christfried Grosse (1732/33–1799) am Pädagogikum Kloster Berge bei Magdeburg, enthalten: Leben, persönliches Umfeld, Quellentexte dazu und zum Werk und seinen Ausgaben, Würdigungen wie Verrisse. Dazu gesellen sich zwei Seiten „Zum Instrumentarium und zur Ausführung“ des Herausgebers, anderthalb Seiten Kritischer Bericht sowie drei Seiten Faksimiles für die zwei- bis viersätzigen Sechs Sonaten (Dessau 1784) und eine Sonatina G-Dur (Halle 1791).
Und die Musik selbst? Zunächst muss man froh sein um jede Ausgabe von Claviermusik aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Diese Zeit war geprägt von hohem Virtuosentum, aber nicht von Komponisten nachhaltiger Qualität – sieht man einmal ab vom einsamen Stern Wolfgang Amadeus Mozart, obgleich seine Zeitgenossen durchaus verstanden, dessen „Streamstil“ aufzunehmen, z. B. in den süddeutschen Barockklöstern. Dieses Repertoire beschränkte sich durchaus auf Manualmusik, die ebenso gut auf der Orgel, viel besser aber mit ihrer geforderten Wechseldynamik auf dem Clavichord dargestellt werden konnte.
Für Clavichorde sind denn auch Grosses Sonaten in erster Linie gedacht – sieht man von Orgeln ab, die mehr 8’-Stimmen denn andere Register, wie z. B. in Markt Nordheim (Johann Bernhard Ehrlich, 1786, I/13) oder mehrere Manuale mit vielfältigen Klangfarben, insbesondere barocke Sreicherstimmen, haben. Auch der Klaviaturumfang bis hinab zum B1 bestätigt dies; Hammerklaviere sind natürlich ebenso denkbar. Die Sonaten-Sätze sind überschrieben mit „Allegretto é gracioso con Variaz.“, „Tempo die Minuetto. Grazioso“, „Largo affettuoso“, „Poco allegro è con viva espressione“, aber auch „Allegretto scherzando“ und „Presto assai“, was bereits darauf hindeutet, dass hier intimer Ausdruck vor raschem Tastengeklingel verlangt ist. Dafür steht vor allem die VI. Sonate in e-Moll, deren langsamer Satz ausdrucksstarke Musikalität einfordert. Andere Moden zeigt z. B. der Variationssatz der I. Sonate in C-Dur; er erinnert an Mozarts zwölf Variationen über das französische Lied Ah! vous dirai-je, Maman, KV 265 (Hoffmann von Fallersleben: Morgen kommt der Weihnachtsmann), und das nicht im Vor-Alpenraum, sondern in der norddeutschen Tiefebene! Die Sonaten verlangen einige Fingerfertigkeit, aber vor allem liebevolle Gestaltung. Harmonisch erfindungsreich (bis hin zu einem vermollten Es-Dur) erinnern sie an eine Zeit, der Carl Philipp Emanuel das Schwelgen im stundenlangen Phantasieren vorgegeben hatte, jenseits aller Polyphonie. Schöne und gute Musik ist das allemal, nur nicht für den Konzertsaal oder die symphonische Orgel; eher nimmt sie den intimen Stil vorweg, der dann die Anfänge eines häuslich familiären Biedermeiers prägte.
Rainer Goede