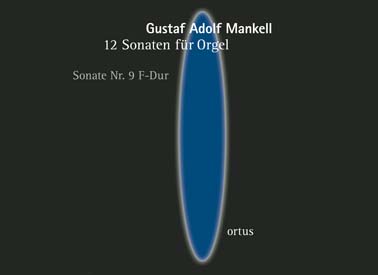Gustav Adolf Mankell
12 Sonaten für Orgel
Sonate Nr. 7 As-Dur / Sonate Nr. 8 A-Dur / Sonate Nr. 9 F-Dur, hg. von Siegfried Mangold
Mitunter stößt man auf Schätze, die man gar nicht gesucht hat. So werde ich in Zukunft beim Namen Mankell nicht nur an den bekannten Autor zahlreicher Kriminalromane denken, sondern auch an den über ein Jahrhundert früher lebenden Organisten. Gustav Adolf Mankell (1812–80) bekleidete bereits als 24-Jähriger die Organistenstelle der Jakobskirche in Stockholm bis zu seinem Lebensende. 1841 wurde er Mitglied der Königlich Schwedischen Musikakademie und erhielt dort 1859 eine Professur. Mit der Einführung der École d’Orgue von Jacques-Nicolas Lemmens als Lehrwerk am dortigen Konservatorium sorgte sich Mankell um eine Anhebung der künstlerischen Standards. Daneben verfasste er selbst für die Studierenden kleine Lehrstücke in allen Dur- und Moll-Tonarten.
Seine 12 Orgelsonaten entstanden hingegen erst zwischen 1874 und 1877 und folgen einem Grundmuster. Der erste, meist längste Satz ist als Sonatenhauptsatz mit zwei kontrastierenden Themen geschrieben, an welches sich ein Fugato anschließt. Danach folgen vier bis fünf meist kürzere Sätze mit den typischen zeitgenössischen Formen wie Menuett, Scherzo, Adagio, Choralvariationen etc.
Bereits der erste Satz der 7. Sonate in As-Dur hat nahezu symphonische Ausmaße. Man ist daher vielleicht versucht, die Wiederholungen des ersten Teils wegzulassen, aber für die Rezeption des von Mankell präsentierten vielfältigen thematischen Materials wäre dies eher kontraproduktiv. Einige enharmonisch verwechselte Stellen sind nicht leicht zu lesen. Die Einstudierung wird jedoch dadurch erleichtert, dass die häufig auftretenden Sequenzen ziemlich regelmäßig angelegt sind. Die Stimmführung ist geschmeidig und zeigt den versierten Kontrapunktiker. Lediglich an die zeitweisen Parallelführungen von linker Hand und Pedal (wohl aus klanglichen Gründen) muss man sich etwas gewöhnen. So akkurat wie die Stimmführung ist auch Mankells autographe Handschrift, von der in den jeweiligen Bänden zumindest eine Seite abgedruckt ist und die eine grundsätzliche Idee für die Ausführung dieser Musik gibt: eben mit Akkuratesse.
Nach dem monumentalen Eingangssatz folgt auf ein lyrisches „Allegretto“ ein Solo für Flûte harmonique. Ausschweifende Melodieführungen französischer Provenienz sucht man hier vergebens, findet dafür aber motivisch „neobarocke“ Verspieltheit. Bemerkenswert ist die explizite Benennung des typisch romantischen französischen Orgelregisters, das auch in der opulent besetzten Orgel der Stockholmer Jakobskirche, deren Disposition im Vorwort abgedruckt ist, vorhanden war. Mankell zeigte starkes Interesse am zeitgenössischen europäischen Orgelbau und ließ die Erfahrungen seiner diesbezüglichen Reisen an „seinem“ Instrument stetig einfließen. Insofern sind auch die zahlreichen Registrierangaben seiner Sonatensätze erfreulich und hilfreich. Etwas seltsam muten in diesem Umfeld klarer Klangvorstellung nur die regelmäßig auftretenden etwas saloppen Bezeichnungen wie „Svällaren begagnas mycket“ (Schweller häufig verwenden) an.
Der vierte Satz der Sonate, schlicht mit „Pedal-Etüde“ betitelt, ist durch die Akkordik im Pedal schwer zu spielen und erfordert eine absolut präzise und kontrollierte Bewegungstechnik. – Nach dem Choral „Gott sey Dank in aller Welt“ mit sieben meist kurzen Variationen beschließt ein zweiteiliges, nach Art einer Introduktion und Fuge angelegtes Finale diese Sonate wahrlich symphonischen Ausmaßes. Wahrscheinlich muss es in Takt 44: linke Hand statt ganze Note b eventuell heses oder his heißen.
Auch die 8. Sonate in A-Dur wartet zu Beginn mit einem opulenten und thematisch vielschichtigen, in der obigen Weise beschriebenen Hauptsatz auf, gefolgt von einem an Mendelssohn erinnernden „Andante religioso“. Das Trio des anschließenden Menuetts spielt gekonnt mit Verschiebungen von Taktschwerpunkten zwischen Dreiviertel- und Sechsachtel-Takten. – An die beschwingte Canzonetta in der Paralleltonart mit quirligem Mittelteil in Fis-Dur schließt ein Allegro moderato in der Dominante der Grundtonart an, welches mit chromatischen Abwärtsrückungen in Takt 43–45 überrascht. Der angehängte Schlussteil des ausladenden Finales wirkt ab Takt 177 wie eine Art Stretta und bringt das
Kabinettstückchen wirkungsvoll zu Ende.
Die Sonate Nr. 9 F-Dur ist insgesamt etwas schlichter und kürzer als die beiden vorangegangenen Werke. Auffällig ist im Eröffnungssatz, dass Mankell den noch nicht bei allen Instrumenten der Zeit bis zum f3 ausgebauten Umfang der Klaviaturen voll ausnutzt. Bisweilen fordert er auch hier wie bei vielen Sätzen weite Griffe der Hände. Bereits an zweiter Stelle der Sonate steht ein in seiner Diktion an Josef Gabriel Rheinberger gemahnendes Menuett. Etwas skurril erscheint hier die optisch eine Bewegung suggerierende Enharmonik in Takt 12. Das folgende Adagio erinnert an ein Lied ohne Worte Mendelssohns. Nach einem verspielten Allegretto wird das Finale erneut mit einer längeren Fuge beschlossen.
Die Musik präsentiert sich insgesamt in eher konservativ-klassizistischem Gewand und wirkt wegen gewisser häufig auftretender Muster wie chromatische Modulation, Sequenzierung sowie etwas marottenhafter Enharmonik bisweilen dekorativ. Unbestritten aber verbreitet sie stets gute Laune und ist allemal eine Entdeckung.
Das Druckbild des ortus-Musikverlags ist hervorragend lesbar, ein interessantes Vorwort in Deutsch und Englisch, versehen mit einem kritischen Bericht der jeweils präsentierten Sonate, rundet das positive Gesamtbild der Edition ab.
Christian von Blohn